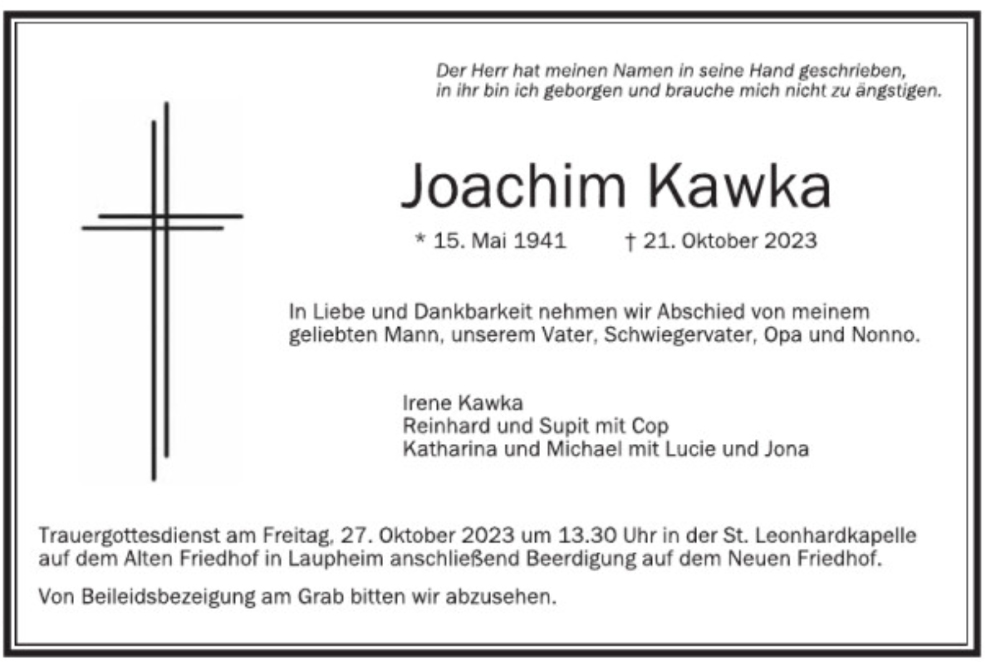Recherche fördert weitere
NS-Verfolgte mit Bezug zu Laupheim zutage - Auf jüdischem Friedhof wird
an sie erinnert.
Von Christian Reichl Schwäbische Zeitung
vom 27.01.2023
„Ihr Sterben soll
uns allzeit mahnen“, diese Worte prangen auf der bronzenen
Gedenktafel, die an der Giebelseite des Hauses am jüdischen
Friedhof angebracht ist. Auf ihr zu lesen sind die Namen von 102
Holocaust-Opfern. Jetzt wurde anlässlich des heutigen Gedenktags
für die Opfer des Nationalsozialismus eine neue Tafel unter der
bereits vorhandenen Plakette installiert. Sie erinnert an die
Schicksale von weiteren 53 jüdischen Menschen, die ebenfalls den
Tod durch die nationalsozialistische Verfolgung von 1933 bis
1945 fanden.
Augenscheinlich
unterscheidet sich die neue Gedenktafel von der 1984
angebrachten nur im Farbton. Auf der bronzenen Platte hat die
Witterung ihre Spuren hinterlassen. „In einigen Jahren wird die
neue Tafel dieselbe Patina haben wie die alte“, sagt Michael
Schick, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für
Geschichte und Gedenken (GGG).
Die neue
Gedenktafel erinnert nun an 53 weitere Menschen, die durch die
nationalsozialistische Verfolgung starben. „Auf der Tafel stehen
die Namen von Menschen, die in Laupheim geboren wurden, hier
lebten oder von Laupheim aus deportiert wurden“, berichtet
Schick. Die Kriterien sind laut Schick dieselben, die bereits
für die alte Gedenktafel zugrunde gelegt wurden. Ein prominentes
Beispiel hierfür nennt Schick mit dem Laupheimer
Jugendstilkünstler Friedrich Adler, der auch auf der Tafel
steht, obwohl er später in Hamburg lebte. Im Juli 1942 wurde der
Kunstprofessor von Hamburg aus nach Auschwitz deportiert. Zur
letztgenannten Gruppe gehörten etwa die Juden, die das frühere
Rabbinat am Synagogenweg, in dem die Nationalsozialisten ein
jüdisches Zwangsaltenheim einrichteten, beziehen mussten, aber
auch die jüdischen Menschen, „die durch die Wirren des Krieges
hier gelandet sind“, wie der 55-Jährige erklärt.
Er erinnert
daran, dass schon in den 1990er-Jahren zwei Namen auf der alten
Tafel ergänzt wurden, der von Ludwig Haymann, und der von
Janette Oppenheimer geborene Heumann. „Man rechnete schon damals
mit wesentlich mehr Menschen, die Opfer der Shoa wurden“,
erklärt Schick. Die früheren Recherchen gestalteten sich aber
schwierig, weil sich die Gedenkarbeit auf Erinnerungen von
Zeitgenossen der Opfer stützen musste. „Die ersten
Aufzeichnungen waren Erinnerungen von ehemaligen KZ-Häftlingen
und handgeschrieben. Heute sind alle Archive digitalisiert“,
sagt der Laupheimer. Mit wenigen Klicks spuckt ein Computer
inzwischen alle Treffer mit der Übereinstimmung eines Namens
aus. So konnten mit den jüngsten Recherchen 155 Opfer der Shoa
mit Bezug zu Laupheim identifiziert werden.
Unter den bislang
nicht namentlich bekannten Opfern, an die nun erinnert wird, ist
der Handelsvertreter Isidor Weil, geboren am 21. August 1875 in
Metzentürm, und seine Frau Elsa - Geburtsname Kahn -, geboren am
17. November 1882 in Ludwigsburg. Die Familie wurde im September
1939 von der Ulmer Sammelunterkunft ins ehemalige Laupheimer
Rabbinat zwangseingewiesen. Das Ehepaar wurde mit dem letzten
Deportationszug von Laupheim aus, am 19. August 1942, ins
Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Die Tochter,
Edith Antonie, geboren am 24. Oktober 1926 in Ulm, brachten die
Nationalsozialisten am 23. August 1943 nach Theresienstadt.
Isidor Weil starb am 7. Februar 1943 in Theresienstadt, Elsa und
Edith wurden am 12. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und
ermordet.
„Wir bleiben an
der Gedenkarbeit dran“, sagt Elisabeth Lincke, die Vorsitzende
der GGG. Beide Vorsitzenden betonen, dass die Recherche um die
Opfer der Shoa ein nicht endender Prozess sei. Deshalb steht auf
der neuen Tafel auch „Ergänzt 2023“. „Das soll zeigen, dass das
wahrscheinlich nicht das Ende ist“, sagt Lincke.
Wie schwierig die
Recherche aber auch sein kann, erfuhr der Lokalhistoriker
Michael Schick, von Beruf Kriminaltechniker, bei seiner Suche in
den Datenbanken. Denn, in den Archiven, der Datenbank der
Internationalen Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, in der
etwa 4,5 Millionen Datensätze gespeichert sind, im Bundesarchiv
in Koblenz und in der genealogischen Datenbank des Jüdischen
Museums Hohenems sowie im Arlosen Archiv stößt er auch auf
Dopplungen. „Man muss sich die Datensätze genau anschauen,
teilweise gibt es mehrere identische Einträge, einer unter dem
Geburtsnamen, ein anderer unter dem Familiennamen“, so Schick.
Bei seinen Recherchen unterstützen ihn die Vorsitzende und
Michael Niemetz, Leiter des Museums zur Geschichte von Christen
und Juden, die sich seit Jahren mit der Genealogie der
ehemaligen jüdischen Laupheimer Familien beschäftigen.
Auch für die
Zukunft schließt Schick nicht aus, dass die Opferzahlen nach
oben korrigiert werden müssen, obwohl „große Entdeckungen von
weiteren Opfern eher ausgeschlossen“ sind. „Wir haben jetzt aber
noch eine Person zuordnen können, die unter Laubheim eingetragen
war“, berichtet Schick. Diese Falschschreibung verhinderte
bislang den entscheidenden Treffer. Weitere Forschung streben er
und der Verein zu den Geschichten hinter den Namen an. „Wir
versuchen zu den einzelnen Schicksalen die Biografien zu
recherchieren.“
Sicher ist man
sich bei der GGG, dass die Forschung zu anderen Opfergruppen in
Laupheim nötig ist. So konnten die Historiker weitere 20 Opfer
der Euthanasie und vier von den Nationalsozialisten ermordete
Sinti und Roma ermitteln. „Wichtig ist uns, dass an die Menschen
nicht nur auf einer Tafel erinnert wird, sondern auch auf
unserer Internetseite, so können die Nachkommen von NS-Opfern
uns finden“, sagt Schick. Die Daten zu den Opfern des
Nationalsozialismus und auch das erstmals 2008 erschienene
Gedenkbuch „Die jüdische Gemeinde Laupheim und ihre Zerstörung“,
zu den Biografien von Mitgliedern der ehemaligen jüdischen
Gemeinde in Laupheim, sind über die Internetseite der GGG
abrufbar.
Angestoßen durch
Mitglieder der ehemaligen jüdischen Gemeinde setzt sich die GGG
laut Satzung für die Erforschung der Ortsgeschichte Laupheims,
insbesondere im Hinblick auf die jüdische Geschichte, ein,
betont Elisabeth Lincke. Die Erinnerung an die jüdische
Gemeinde, die gewaltsam durch die Nationalsozialisten ausradiert
wurde, und die Pflege ihres Andenkens möchte der Verein in
seiner Erinnerungsarbeit bewahren.
Weitere
Informationen über die Arbeit der GGG gibt es unter
www.ggg-laupheim.de
Das Digitalisat
zum Gedenkbuch finden Interessierte unter
www.gedenk-buch.de

Opfern der Shoa einen Namen geben
Laupheim gedenkt
NS-Verfolgten - neue Tafel auf dem jüdischen Friedhof
enthüllt.

Von Christian
Reichl Schwäbische Zeitung vom 28.01.2023
Eine neue
Gedenktafel am jüdischen Friedhof erinnert nun an die Schicksale
von weiteren 53 Holocaust-Opfern mit einem Bezug zu Laupheim.
Die Stadt hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags (27. Januar
2023) die Ergänzung der bestehenden Platte am Abend zuvor
enthüllt. Rund 100 Menschen waren als Gäste gekommen.
An die Befreiung
des Vernichtungslagers Auschwitz vor 78 Jahren erinnerte
Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann in seiner Begrüßung.
Auschwitz nannte er das „dunkelste und schlimmste Kapitel
deutscher Geschichte“. Auschwitz als Sinnbild des Bösen, aber
auch die vielen anderen Vernichtungslager, die nur geschaffen
wurden, um Menschen zu töten, zeigten, was „Menschen anderen
Menschen antun können“, mahnte der OB. Dank des besseren Zugangs
zu Informationen sei es heute möglich, mehr über die Schicksale
der Verfolgten zu erfahren. Er dankte allen, die es in Bezug auf
Laupheim ermöglichten, „dass wir ihre Namen kennen“. Sein Dank
galt auch Michael Steiner, angereist mit seiner Familie aus der
Schweiz, der die neue Gedenktafel mit einer Geldspende
ermöglicht habe.
Wie ehemalige
Mitglieder der jüdischen Gemeinde schon kurz nach Kriegsende
wieder Kontakt nach Laupheim aufnahmen, schilderte Michael
Niemetz, Leiter des Museums für Christen und Juden in Laupheim.
Niemetz las aus dem Schriftverkehr zwischen Ruth Rieser, welche
die NS-Verfolgung überlebt hatte, und dem von den Alliierten
eingesetzten Bürgermeister Josef Hyneck vor. Obwohl zwei
Schwestern von Rieser in Theresienstadt von den Nazis umgebracht
worden waren, habe sie sich an die Verwaltung in Laupheim
gewandt und sich darum bemüht, dass an die in den
Konzentrationslagern ermordeten Mitglieder der ehemaligen
jüdischen Gemeinde in Laupheim erinnert wird. Schon damals
nannte Rieser sechs Namen, die erst jetzt auf der neuen Tafel
aufgeführt sind. Dies stehe exemplarisch dafür, wie Historiker
lange mit Überlieferungsproblemen zu kämpfen hatten. Anhand der
wichtigsten Stationen zeigte Niemetz, wie sich die
Erinnerungsarbeit in Laupheim von der ersten jüdischen Abteilung
im Heimatmuseum und der Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof
im Jahr 1978 bis zur Einweihung der neuen Tafel entwickelt
hatte. „Mit der Gedenktafel können wir den Opfern jetzt einen
Namen geben“, so Niemetz.
Michael Steiner,
Sohn von Yitzhak Heinrich Steiner, übermittelte eine
Grußbotschaft seiner Tante, Martina Frank-Steiner, in der diese
die Verbundenheit zu Laupheim und ihre Anerkennung für die
Gedenkarbeit aussprach.
Zu den jüngsten
Recherchen in den NS-Archiven berichtete Michael Schick,
stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Geschichte
und Gedenken (GGG) und Betreuer des jüdischen Friedhofs. Nach
einer ersten Recherche sei er auf immer mehr Namen mit Bezug zu
Laupheim gestoßen. Doch einige Datensätze hätten sich gedoppelt.
Gemeinsam mit Museumsleiter Michael Niemetz und der Vorsitzenden
der GGG, Elisabeth Lincke, recherchierte er die 53 Namen der
Menschen, an die nun auf der ergänzten bronzenen Platte erinnert
wird (SZ berichtete). Damit steige die Gesamtzahl allein der
jüdischen NS-Opfer mit Bezug zu Laupheim auf insgesamt 155
Menschen. Weitere 20 Opfer gibt es für Laupheim durch die
Euthanasie zu beklagen - die Ermordung von kranken und
behinderten Menschen - weitere vier Opfer sind Sinti und Roma.
Schicks nächstes Projekt wird sich den Krankenmorden widmen.
Rabbiner Shneur
Trebnik aus Ulm versinnbildlichte anhand einer bekannten
Anekdote, über die Begegnung zwischen Napoleon und einer Gruppe
von Juden, die sich über die Zerstörung des Jerusalemer Tempels
unterhalten, dass das Judentum nicht nur eine bedeutende
Vergangenheit, sondern auch Gegenwart habe. Dafür würden auch
die „zahlreichen Menschen, die hier stehen“ sprechen. Zur
Zukunft sprach er aber auch mahnende Worte: Jeder solle sich auf
dem Nachhauseweg überlegen, was er tun könne, damit die Shoa
sich nicht wiederhole und es keine neuen Gedenktafeln brauche.
Dann betete der Rabbiner den Psalm 130 auf Deutsch und
Hebräisch.
Petr Hemmer
(Violine) und Helmut Zeihsel (Piano) von der Musikschule
Gregorianum umrahmten die Veranstaltung musiklaisch. Sie
spielten „Wär ich wirklich so falsch“ und „Mein Geist ist trüb“
aus den Hebräischen Gesängen, die aus der Feder des in Laupheim
geborenen jüdischen Komponisten Moritz Henle stammen. Außerdem
ein Andante aus einer Violinsonate von Bach.
Eine Führung zur
neuen Gedenktafel bietet Michael Schick am Sonntag, 29. Januar
2023,
um 14 Uhr an. Treffpunkt ist am Haus am jüdischen Friedhof.

New memorial
plaque for another 53 Holocaust
victims
Research uncovers further victims of Nazi
persecution with a connection to Laupheim - They are commemorated on
Jewish cemetery
By Christian Reichl Schwäbische Zeitung from Jan 27,2023
Michael Schick has come across more names of Jewish people who had
a connection to Laupheim in archives on Nazi persecution. Below the
already existing memorial plaque, an extension recalls their fates.
(Photo: Reichl)
In archives on Nazi persecution, Michael Schick has come across
further names of Jewish people who had a connection to Laupheim. Under
the already existing memorial plaque, an extension recalls their fates.
"Their deaths shall always remind us," these words are emblazoned
on the bronze memorial plaque attached to the gable end of the house at
the Jewish cemetery. The names of 102 Holocaust victims can be read on
it. Now, on the occasion of today's Memorial Day for the Victims of
National Socialism, a new plaque has been installed under the existing
one. It commemorates the fates of another 53 Jewish people who also met
their deaths as a result of Nazi persecution from 1933 to 1945.
Apparently, the new memorial plaque differs from the one installed
in 1984 only in the color tone. The weather has left its mark on the
bronze plate. "In a few years, the new plaque will have the same patina
as the old one," says Michael Schick, vice chairman of the Society for
History and Remembrance (GGG).
The new memorial plaque now commemorates 53 other people who died
as a result of National Socialist persecution. "On the plaque are the
names of people who were born in Laupheim, lived here or were deported
from Laupheim," Schick reports. According to Schick, the criteria are
the same as those used for the old memorial plaque. Schick cites a
prominent example of this with the Laupheim Art Nouveau artist Friedrich
Adler, who is also on the plaque, although he later lived in Hamburg. In
July 1942, the art professor was deported from Hamburg to Auschwitz. The
latter group included, for example, the Jews who had to move into the
former rabbinate on Synagogenweg, where the National Socialists set up a
Jewish forced home for the elderly, but also the Jewish people "who
ended up here through the turmoil of the war," as the 55-year-old
explains.
He recalls that already in the 1990s two names were added to the
old plaque, that of Ludwig Haymann, and that of Janette Oppenheimer née
Heumann. "Even then, it was expected that there would be many more
people who were victims of the Shoa," Schick explains. But the earlier
research proved difficult because the memorial work had to rely on
memories of contemporaries of the victims. "The first records were
memories of former concentration camp prisoners and handwritten. Today,
all the archives are digitized," says the Laupheimer. With just a few
clicks, a computer now spits out all the hits that match a name. In this
way, the most recent research made it possible to identify 155 victims
of the Shoa with a connection to Laupheim.
Among the victims not previously known by name, who are now being
remembered, is the commercial agent Isidor Weil, born on August 21, 1875
in Metzentürm, and his wife Elsa - birth name Kahn - born on November
17, 1882 in Ludwigsburg. The family was forcibly transferred from the
Ulm collective housing to the former Laupheim rabbinate in September
1939. The couple was deported to the Theresienstadt concentration camp
on the last deportation train from Laupheim, on August 19, 1942. The
daughter, Edith Antonie, born in Ulm on October 24, 1926, was taken to
Theresienstadt by the Nazis on August 23, 1943. Isidor Weil died in
Theresienstadt on February 7, 1943, and Elsa and Edith were deported to
Auschwitz and murdered on October 12, 1944.
"We are staying on top of the memorial work," says Elisabeth
Lincke, chairwoman of the GGG. Both chairpersons emphasize that
researching the victims of the Shoa is a never-ending process. That's
why the new plaque also says "Supplemented 2023." "This is to show that
this is probably not the end," says Lincke. However, local historian
Michael Schick, a forensic scientist by profession, learned just how
difficult research can be when he searched the databases. Because, in
the archives, the database of the International Memorial Yad Vashem in
Jerusalem, in which about 4.5 million records are stored, in the Federal
Archives in Koblenz and in the genealogical database of the Jewish
Museum Hohenems as well as in the Arlosen Archive, he also comes across
duplicates. "You have to look closely at the records, sometimes there
are several identical entries, one under the birth name, another under
the family name," Schick says. He is supported in his research by the
chairwoman and Michael Niemetz, director of the Museum of the History of
Christians and Jews, who have been working on the genealogy of former
Jewish Laupheim families for years.
Schick also does not rule out the possibility that the number of
victims will have to be revised upward in the future, although "major
discoveries of additional victims are rather out of the question."
"However, we have now been able to assign one more person who was
registered under Laubheim," Schick reports. This misspelling has so far
prevented the decisive hit. He and the association are striving for
further research into the stories behind the names. "We are trying to
research the biographies of the individual fates."
One is sure at the GGG that research is needed on other groups of
victims in Laupheim. For example, the historians were able to identify
another 20 victims of euthanasia and four Sinti and Roma murdered by the
Nazis. "It is important to us that people are not only remembered on a
plaque, but also on our website, so the descendants of Nazi victims can
find us," says Schick. The data on the victims of National Socialism and
also the memorial book "Die jüdische Gemeinde Laupheim und ihre
Zerstörung" (The Jewish Community of Laupheim and its Destruction),
first published in 2008, on the biographies of members of the former
Jewish community in Laupheim, are available on the GGG website.
Initiated by members of the former Jewish community, the GGG,
according to its statutes, is committed to researching the local history
of Laupheim, especially with regard to Jewish history, emphasizes
Elisabeth Lincke. The association would like to preserve the memory of
the Jewish community, which was forcibly wiped out by the National
Socialists, and the care of its memory in its commemorative work.
Giving victims of the Shoa a name
Laupheim commemorates
victims of Nazi persecution - new plaque unveiled at Jewish cemetery
 T
T
The extension of the memorial plaque at the Jewish cemetery gives a
name to Nazi victims with a connection to Laupheim. At the unveiling of
the new plaque (from left): Laupheim's mayor Ingo Bergmann, Michael
Schick, Michael Niemetz and Michael Steiner. (PhotoS: Christian Reichl)
By Christian Reichl Schwäbische Zeitung from Jan. 28,2023
A new memorial plaque at the Jewish cemetery now commemorates the fates
of another 53 Holocaust victims with a connection to Laupheim. The city
unveiled the addition to the existing plaque the previous evening on the
occasion of Holocaust Remembrance Day (Jan. 27). About 100 people had
come as guests.
Laupheim's mayor Ingo Bergmann recalled the liberation of the Auschwitz
death camp 78 years ago in his welcoming speech. He called Auschwitz the
"darkest and worst chapter of German history". Auschwitz as a symbol of
evil, but also the many other extermination camps that were created only
to kill people, showed what "people can do to other people," the mayor
warned. Thanks to better access to information, he said, it is now
possible to learn more about the fates of those persecuted. He thanked
all those who, in relation to Laupheim, made it possible "that we know
their names." He also thanked Michael Steiner, who had traveled with his
family from Switzerland, who had made the new memorial plaque possible
with a monetary donation.
Michael Niemetz, director of the Museum for Christians and Jews in
Laupheim, described how former members of the Jewish community
re-established contact with Laupheim shortly after the end of the war.
Niemetz read from correspondence between Ruth Rieser, who had survived
Nazi persecution, and Josef Hyneck, the mayor appointed by the Allies.
Although two of Rieser's sisters had been killed by the Nazis in
Theresienstadt, she had approached the administration in Laupheim and
asked that the members of the former Jewish community in Laupheim who
had been murdered in the concentration camps be remembered. Even then,
Rieser mentioned six names that are only now listed on the new plaque.
He said that this was an example of how historians had to struggle with
problems of transmission for a long time. Using the most important
stages, Niemetz showed how the commemorative work in Laupheim had
developed from the first Jewish section in the local history museum and
the commemoration ceremony at the Jewish cemetery in 1978 to the
dedication of the new plaque. "With the memorial plaque, we can now give
the victims a name," Niemetz said.
Michael Steiner, son of Yitzhak Heinrich Steiner, conveyed a message of
greeting from his aunt, Martina Frank-Steiner, expressing her attachment
to Laupheim and her appreciation for the memorial work.
Michael Schick, deputy chairman of the Society for History and
Remembrance (GGG) and caretaker of the Jewish cemetery, reported on the
latest research in the Nazi archives. After an initial search, he said,
he came across more and more names related to Laupheim. But some records
were duplicated. Together with museum director Michael Niemetz and the
chairwoman of the GGG, Elisabeth Lincke, he researched the 53 names of
the people who are now commemorated on the supplemented bronze plate (SZ
reported). He added that this brings the total number of Jewish Nazi
victims with a connection to Laupheim alone to a total of 155 people.
There are another 20 victims to mourn for Laupheim through euthanasia -
the murder of sick and disabled people - another four victims are Sinti
and Roma. Schick's next project will be dedicated to the murders of the
sick.
Rabbi Shneur Trebnik from Ulm used a well-known anecdote, about the
encounter between Napoleon and a group of Jews discussing the
destruction of the Jerusalem Temple, to illustrate that Judaism not only
has a significant past, but also a present. The "numerous people
standing here" would also speak for that. But he also spoke cautionary
words about the future: everyone should think about what they can do on
their way home so that the Shoa does not happen again and there is no
need for new memorial plaques. Then the rabbi prayed Psalm 130 in German
and Hebrew.
Petr Hemmer (violin) and Helmut Zeihsel (piano) from the Gregorianum
Music School provided the musical framework for the event. They played
"Wär ich wirklich so falsch" and "Mein Geist ist trüb" from the Hebrew
Songs, penned by the Laupheim-born Jewish composer Moritz Henle. Also,
an andante from a violin sonata by Bach.
A guided tour of the new memorial plaque will be offered by Michael
Schick on Sunday, January 29, at 2 pm. Meeting point is at the house at
the Jewish cemetery.
 Erinnern,
damit sich Geschichte nicht wiederholt: Auf dem Ernst-Schäll-Platz vor
dem jüdischen Friedhof haben am Mittwochabend Laupheimerinnen und
Laupheimer der Verbrechen an der jüdischen Gemeinde in Laupheim und der
Zerstörung der örtlichen Synagoge in der Reichspogromnacht am 9.
November 1938 gedacht. Bewohnerinnen und Bewohner des Heggbacher
Wohnverbunds der St.-Elisabeth-Stiftung erinnerten an das Schicksal des
Laupheimers Karl Guggenheimer, der im Jahr 1940 in die Heil- und
Pflegeanstalt Heggbach eingewiesen und knapp anderthalb Jahre später
vermutlich in Stuttgart ermordet wurde. Elisabeth Lincke, Vorsitzende
der Gesellschaft für Geschichte und Gedenken, verlas eine Rede von Karl
Guggenheimers Großnichte, Liliana Löwenstein. Neben dem Dank für die
Erinnerungsarbeit, richtete sie auch mahnende Worte an die Laupheimer.
Erinnern,
damit sich Geschichte nicht wiederholt: Auf dem Ernst-Schäll-Platz vor
dem jüdischen Friedhof haben am Mittwochabend Laupheimerinnen und
Laupheimer der Verbrechen an der jüdischen Gemeinde in Laupheim und der
Zerstörung der örtlichen Synagoge in der Reichspogromnacht am 9.
November 1938 gedacht. Bewohnerinnen und Bewohner des Heggbacher
Wohnverbunds der St.-Elisabeth-Stiftung erinnerten an das Schicksal des
Laupheimers Karl Guggenheimer, der im Jahr 1940 in die Heil- und
Pflegeanstalt Heggbach eingewiesen und knapp anderthalb Jahre später
vermutlich in Stuttgart ermordet wurde. Elisabeth Lincke, Vorsitzende
der Gesellschaft für Geschichte und Gedenken, verlas eine Rede von Karl
Guggenheimers Großnichte, Liliana Löwenstein. Neben dem Dank für die
Erinnerungsarbeit, richtete sie auch mahnende Worte an die Laupheimer.


 Von
Karl Guggenheimer gibt es noch Fotos. Sie stammen alle vom gleichen Tag
im Jahr 1940. Sie sind im Altersheim in Laupheim aufgenommen worden.
Dort müssen ältere jüdische Menschen auf engem Raum zusammen wohnen. Auf
einem Bild steht Karl zwischen zwei anderen Männern. Sein Kopf ist
leicht geneigt und er blickt fest nach vorn.
Von
Karl Guggenheimer gibt es noch Fotos. Sie stammen alle vom gleichen Tag
im Jahr 1940. Sie sind im Altersheim in Laupheim aufgenommen worden.
Dort müssen ältere jüdische Menschen auf engem Raum zusammen wohnen. Auf
einem Bild steht Karl zwischen zwei anderen Männern. Sein Kopf ist
leicht geneigt und er blickt fest nach vorn.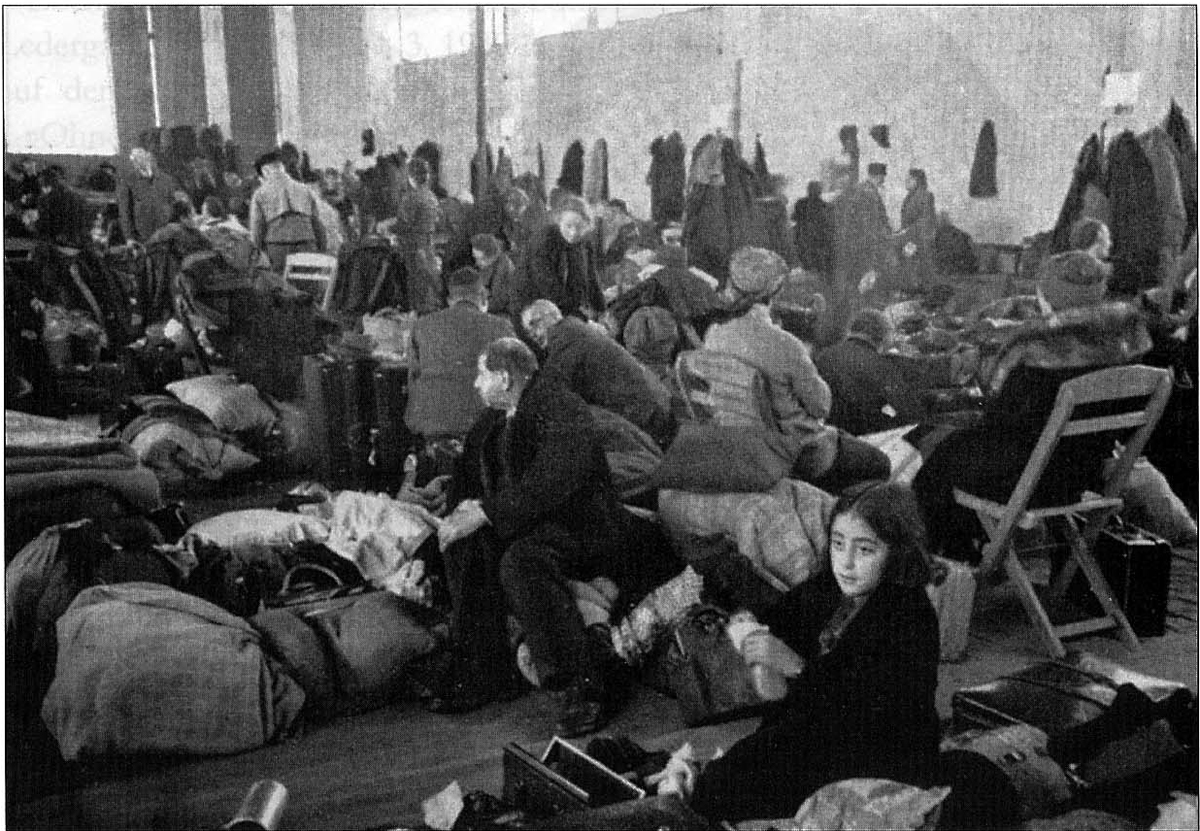 Zuletzt
muss Arthur Grab die gelben Sterne nach Heggbach schicken. Auch Karl
muss eine solchen Stern an seiner Kleidung tragen. Aber bald danach
kommen schon die ersten Befehle: Karl und eine weitere Frau müssen aus
Heggbach weggehen.
Zuletzt
muss Arthur Grab die gelben Sterne nach Heggbach schicken. Auch Karl
muss eine solchen Stern an seiner Kleidung tragen. Aber bald danach
kommen schon die ersten Befehle: Karl und eine weitere Frau müssen aus
Heggbach weggehen.